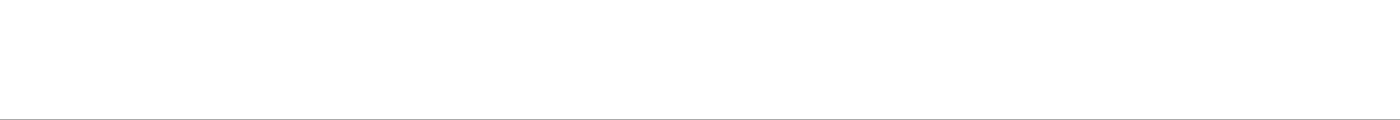Beim „Syndrom des gebrochenen Herzens" ist die Funktion des Herzmuskels gestört. Die Beschwerden sind die gleichen wie bei einem Herzinfarkt – die Diagnose ist deshalb schwierig. Ein Bluttest kann die Diagnose zukünftig erleichtern, berichten deutsche Forscher.
Verwechslungsgefahr
Etwa 2,5 Prozent der Menschen, die mit einem Herzinfarkt-Verdacht ins Krankenhaus kommen, leiden am „Syndrom des gebrochenen Herzens". Dabei handelt es sich um eine Funktionsstörung des Herzmuskels, die während der ersten Stunden gefährlich ist, da lebensbedrohliche Komplikationen auftreten können. Die Störung tritt plötzlich ein – meist nach einer außerordentlichen emotionalen Belastung, zum Beispiel dem Tod einer nahestehenden Person oder einer Kündigung. Sie tritt zu 90 Prozent bei älteren Frauen auf – wohingegen ein Herzinfarkt zu 70 Prozent ältere Männer betrifft.
Die akuten Beschwerden sind bei beiden Erkrankungen gleich: starker Brustschmerz und Luftnot. Auch das EGK weist keine Unterschiede auf. Der Unterschied zeigt sich jedoch nach der akuten Phase: Beim „Syndrom des gebrochenen Herzens" erholt sich die Pumpfunktion des Herzens meist wieder vollständig und nach ein paar Wochen funktioniert der Herzmuskel in der Regel wieder normal. Beim Herzinfarkt entstehen jedoch Narben, die dauerhaft bleiben und das Pumpen beeinträchtigen.
Für eine klare Diagnose ist eine Herzkatheteruntersuchung nötig, bei welcher der Mediziner die Herzkranzgefäße betrachtet: Bei einem Herzinfarkt sind sie geschlossen, bei einem gebrochenen Herz offen.
Im Blut erkennbar
Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und des Universitätsspitals Zürich, Schweiz, haben herausgefunden, dass das „Syndrom des gebrochenen Herzens" anhand von bestimmten Blutwerten der Patienten erkannt werden kann. „Ein bestimmtes Muster aus vier mikroRNAs unterscheidet das Syndrom von einem Herzinfarkt", sagt Prof. Dr. Dr. Thomas Thum, Direktor des MHH-Instituts für Molekulare und Translationale Therapiestrategien (IMTTS).
Ein Bluttest würde die korrekte Diagnose deutlich vereinfachen. „Weitere Studien mit mehr Patienten müssen die Ergebnisse nun bestätigen und Nachweisverfahren für die mikroRNAs müssen schneller werden", sagt Prof. Thum. Die Forscher erwarten, dass der Nachweis in ein paar Jahren in Kliniken verfügbar sein wird.